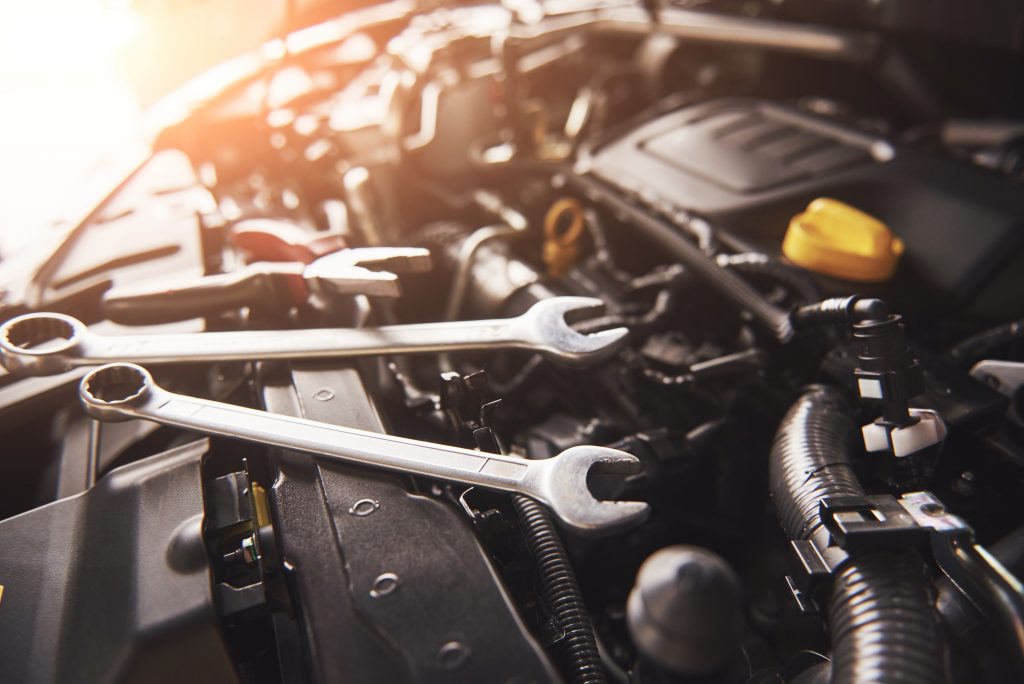
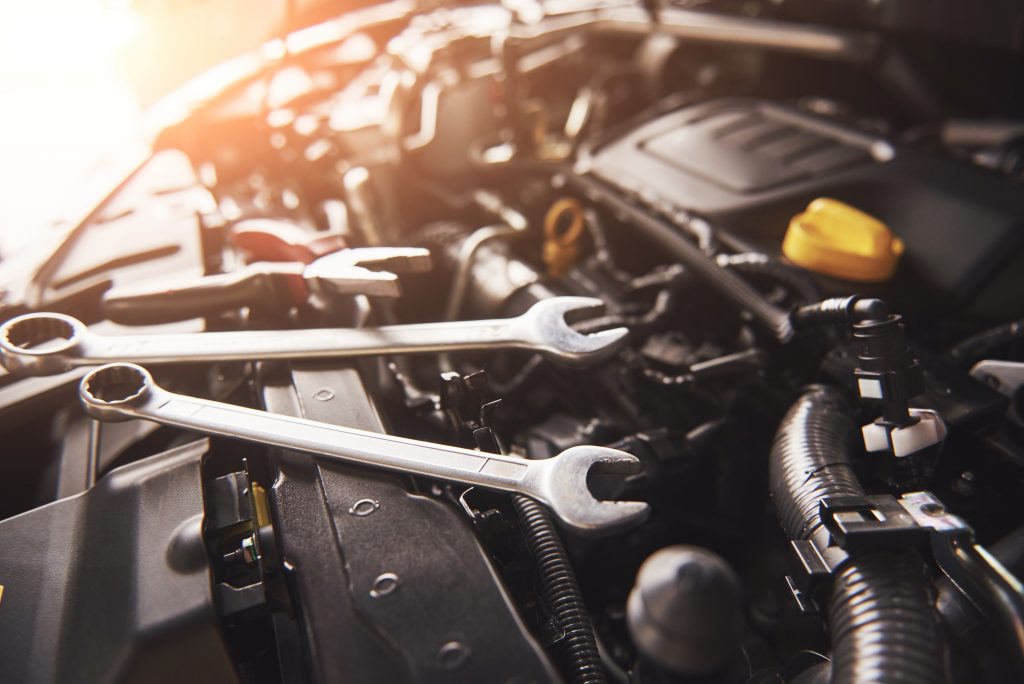
Der Geschädigte kann bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall in die Lage kommen, dass er die Durchführung der Reparatur an seinem Fahrzeug nachweisen muss, sei es bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs, bei fiktiver Abrechnung und Reparatur in Eigenregie oder bei einem neuen Schadensereignis. Dieser Nachweis gegenüber der gegnerischen Versicherung kann durch die Vorlage einer Reparaturbestätigung/Reparaturnachweis geführt werden.
Sofern die Vorlage einer Reparaturbestätigung erforderlich und zweckmäßig ist, sind die Kosten nach § 249 Abs. 2 BGB zu erstatten.
Folgende Fälle können in Betracht kommen:
- Der Geschädigte muss eine Reparatur in Eigenregie (also ohne Rechnungsvorlage) nachweisen, damit er Nutzungsausfall bzw. Mietwagenkosten erstattet bekommt.
- Der Geschädigte repariert sein Fahrzeug nur teilweise, so dass es verkehrssicher und fahrbereit ist, kann aber das Fahrzeug während dieser Zeit nicht nutzen. In diesem Fall kann er den Ausfall durch eine Reparaturbestätigung nachweisen.
- Stellt der Geschädigte an seinem verunfallten Fahrzeug bei Reparaturkosten oberhalb der 130 %-Grenze die Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs wieder her und nutzt es weiter, ist eine Reparaturbestätigung erforderlich, da sich aus dieser ergibt, dass der Geschädigte sein Fahrzeug weiter genutzt hat. Der Geschädigte kann dann im Rahmen der Totalschadensabrechnung den Restwert aus dem eingeholten Gutachten zu Grunde legen und muss sich nicht auf ein höheres Restwertangebot der gegnerischen Versicherung verweisen lassen (vgl. AG Neu-Ulm, Urteil vom 02.01.2014, Az. 3 C 1358/13).
- Der Geschädigte hat einen ersten Haftpflichtschaden fiktiv abgerechnet und hat danach einen weiteren zweiten Haftpflichtschaden. Bei diesem zweiten Schaden muss er dann nachweisen, dass und wie der alte Schaden beseitigt worden ist – zum Beispiel in Eigenregie.
- Der Geschädigte verkauft das verunfallte und in Eigenregie reparierte Fahrzeug weiter und will gegenüber dem Käufer nachweisen, dass und wie der alte Schaden beseitigt worden ist.
Einen solchen Reparaturnachweis fertigt der Sachverständige an. Aus diesem sollte sich ergeben, dass der Sachverständige das Fahrzeug nachbesichtigt hat und dabei festgestellt hat, dass das verunfallte Fahrzeug repariert worden ist und wie lange das gedauert hat.
Die Rechtsprechung der Amtsgerichte zur Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Reparaturbestätigung war bis dato nicht immer einheitlich.
Mit Urteil vom 24.01.2017 hat der BGH (Az. VI ZR 146/16) entschieden, dass die im Rahmen einer tatsächlich erfolgten Reparatur angefallenen Kosten einer Reparaturbestätigung für sich genommen bei einer fiktiven Schadensabrechnung nicht ersatzfähig seien. Es läge nämlich eine Kombination von fiktiver und konkreter Schadensabrechnung vor, die insoweit unzulässig sei.
In dem vom BGH zu entscheidenden Fall hatte die Klägerin auf Gutachtenbasis mit dem Beklagten abgerechnet. Die Reparatur ließ die Klägerin von ihrem Lebensgefährten, einem gelernten Kfz-Mechatroniker vornehmen. Die Ordnungsgemäßheit der Reparatur ließ sie sich von dem Sachverständigen bestätigen, der für die Erstellung der Reparaturbestätigung 61,88 Euro in Rechnung stellte. Um diesen Betrag wurde noch gestritten.
Allerdings – so der BGH – kann etwas anderes gelten, wenn die Reparaturbestätigung aus Rechtsgründen zur Schadensabrechnung erforderlich gewesen wäre, etwa im Rahmen der Abrechnung eines zusätzlichen Nutzungsausfallschadens (vgl. AG Düsseldorf, Urteil vom 30.07.2015, Az. 235 C 11335/14, AG Schwabach, Urteil vom 22.11.2012, Az. 2 C 999/12, AG Mainz, Urteil vom 15.05.2012, Az. 86 C 113/12, AG Frankfurt, Urteil vom 03.02.2011, Az. 29 C 2624/10). Die Reparaturbescheinigung wäre – ihre Eignung im Übrigen vorausgesetzt – dann als Nachweis der tatsächlichen Gebrauchsentbehrung erforderlich zur Rechtsverfolgung im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB. Entsprechendes kann im Fall der den Wiederbeschaffungsaufwand überschreitenden fiktiven Reparaturkosten für den Nachweis der verkehrssicheren (Teil-)Reparatur des Unfallfahrzeugs und damit des tatsächlich bestehenden Integritätsinteresses des Geschädigten (vgl. BGH, Urteil vom 29.04.2003, Az. VI ZR 393/02, BGH, Urteil vom 29. 04.2008, Az. VI ZR 220/07) gelten.
Nicht erstattungsfähig sind die Kosten für die Reparaturbestätigung folglich nur dann, wenn für den Fall eines weiteren Unfallschadens oder eines Verkaufs der Nachweis, dass repariert wurde erbracht werden soll. In den oben genannten Fällen Ziffer 4) und 5) lehnt der BGH also eine Zahlungspflicht der Versicherung ab. Die Kosten muss der Geschädigte in diesem Fall selber tragen; dies kann sich aber lohnen, da – insbesondere bei einem weiteren Unfallschaden – durch eine solche Bestätigung später ein Streit mit der Versicherung um einen reparierten Vorschaden vermieden werden kann.
Die Kosten für eine solche Bestätigung dürfen sich zwischen 60 Euro (vgl. BGH) und 80 Euro bewegen: Das Amtsgericht Berlin-Mitte hat mit Urteil vom 23.04.2014, Az. 21 C 3182/13, Kosten in Höhe von 80,00 Euro und das AG Neu-Ulm mit Urteil vom 02.01.2014, Az. 3 C 1358/13, Kosten in Höhe von 74,38 Euro als angemessen erachtet.
Für das Autohaus heißt das Folgendes:
Für das Autohaus treten hier keine Besonderheiten auf.
Für den Sachverständigen heißt das Folgendes:
Benötigt der Geschädigte eine Reparaturbestätigung und ist diese nach der Rechtsprechung des BGH erforderlich, sollte der Sachverständige einen solche fertigen und hierfür dem Geschädigten ca. 75 Euro in Rechnung stellen.
Für den Geschädigten heißt das Folgendes:
In folgenden Fällen sollt der Geschädigte vom Sachverständigen eine Reparaturbestätigung fertigen lassen: bei teilweiser Reparatur des verunfallten Fahrzeugs, bei fiktiver Abrechnung mit Reparatur in Eigenregie, bei Wiederherstellung der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs und Weiternutzung trotz Totalschadens. Die Kosten für die Reparaturbestätigung kann der Geschädigte bei der gegnerischen Versicherung geltend machen.