Bei Verkehrsunfällen kommt es immer wieder nicht nur zu Sachschäden, sondern auch zu Personenschäden. Welche Positionen unter den Begriff der Personenschaden fallen und welche Kosten Geschädigte ersetzt bekommen, erfahren Sie auf dieser Seite.
Sollten Sie weitere Fragen rund um die Unfallabwicklung haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Verkehrsunfall: Schmerzensgeld wegen Personenschaden?
Nicht immer bleibt es bei Blechschäden nach einem Unfall, manchmal gibt es auch Verletzte. Für die bei einem Unfall erlittenen Verletzungen kann der Geschädigte Schmerzensgeld verlangen. Anspruchsgrundlage hierfür ist § 253 Abs. 2 BGB.
Neben dem Schmerzensgeld gibt es noch weitere Personenschäden: Heilbehandlungskosten, vermehrte Bedürfnisse und Erwerbsschaden. Da der Geschädigte den Personenschaden beweisen muss, muss er geeignete Belege vorlegen. Das können z. B. Arztberichte oder Arztgutachten sein, die meist die Versicherung des Unfallgegners beschafft. Hierfür benötigt die Versicherung eine Erklärung des Geschädigten, dass dieser die ihn behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht befreit, soweit dies aus Anlass des Unfalls erforderlich ist.
Die Versicherung wendet sich dann unter Vorlage der Schweigepflichtentbindungserklärung an die Ärzte und fordert die Berichte in Form von Fragebögen an. Durchschriften dieser Berichte bekommt der Geschädigte bzw. dessen Anwalt, so dass dieser den Schmerzensgeldanspruch beziffern kann.
Schmerzensgeld & Schmerzensgeldtabellen
Die Höhe des Schmerzensgeldes hängt vom Maß der körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen beim Geschädigten ab. Es gibt Schmerzensgeldtabellen mit mehreren tausend zusammengestellten Gerichtsentscheidungen, die nach der Höhe des Schmerzensgeldes oder der Art der Personenschäden gestaffelt sind. Anhand dieser kann die Verletzung des Unfallgeschädigten mit den dort erfassten Fällen verglichen werden.
Zu berücksichtigen sind Art und Umfang der eingetretenen Verletzungen und der Behandlungsmaßnahmen, Heftigkeit und Dauer der erlittenen Schmerzen, Dauer einer etwaigen Arbeitsunfähigkeit sowie ein etwaiger verbleibender Dauerschaden. Auch das Mitverschulden des Geschädigten, ästhetische Beeinträchtigung, Beeinträchtigungen des allgemeinen Lebensgefühls und der Freizeitgestaltung sowie das Alter des Geschädigten spielen eine Rolle.
Einmalzahlung oder Rente beim Schmerzensgeld
Grundsätzlich wird Schmerzensgeld durch eine Einmalzahlung abgegolten. Nur ausnahmsweise gewährt die Rechtsprechung unter engen Voraussetzungen die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Form einer lebenslangen Rente. Hierfür muss der Geschädigte eine schwere Verletzung mit besonders gravierenden Dauerfolgen erlitten haben, durch die sein Leben permanent und schmerzlich aufs Neue beeinträchtigt wird, z. B. beim Verlust oder der Lähmung wichtiger Gliedmaßen.
Personenschaden: Sind vermehrte Bedürfnisse erstattungsfähig?
Vielfach sieht sich der durch einen Unfall Verletzte hohen finanziellen Belastungen ausgesetzt, die über das hinausgehen, was jedermann für seine persönlichen Bedürfnisse aufwenden muss. In dem Fall spricht man von – gegenüber dem Durchschnitt bzw. Unverletzten – vermehrten Bedürfnissen.
Vermehrte Bedürfnisse dienen dem Ausgleich laufender Aufwendungen als Folge eines Dauerschadens. Darunter fallen alle unfallbedingten, regelmäßig erforderlichen Mehraufwendungen, die zum Ausgleich von Nachteilen notwendig sind. Eine besondere gesetzliche Regelung hierfür gibt es in § 843 BGB.
Folgende Schadenspositionen fallen unter vermehrte Bedürfnisse:
- laufende Ausgaben für eine bessere Verpflegung,
- Aufwand für Pflegepersonal,
- orthopädische Schuhe,
- Mehraufwendungen für eine Wohnung in einem anderen Ort,
- Umrüstung eines Pkw,
- erhöhte Ausbildungskosten,
- Kurkosten und
- angepasste Kleidung.
Ist der Geschädigte ein Dauerpflegefall, hat er Anspruch auf Ausgleich des Pflegeaufwandes. Auch wenn diese Leistungen von Angehörigen erbracht werden, sind sie zu erstatten.
Bei lebenslangen Aufwendungen erfolgt in der Regel eine Verrentung der Ansprüche. Die Rentenansprüche können dann nach Maßgabe der gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst werden.
Kosten für Privatärztliche Behandlung
Kosten privatärztlicher Behandlungen sind im Normalfall nicht zu erstatten, da es üblicherweise an der Erforderlichkeit fehlt. Ausnahmsweise sind sie ersatzfähig, wenn das Leistungssystem der Krankenkasse unzureichend ist. Gleiches gilt, wenn der Geschädigte üblicherweise entsprechende Leistungen in Anspruch nimmt und zu den ihn behandelnden Ärzten besonderes Vertrauen gefasst hat.
Kosten der Angehörigen für Krankenbesuch
Zudem können Kosten dadurch entstehen, dass der Geschädigte, der im Krankenhaus liegt, von Angehörigen und Freunden besucht wird. Grundsätzlich sind Aufwendungen von dritten Personen nicht ausgleichspflichtig, es gibt aber Ausnahmen. Sind die Besuche medizinisch notwendig und dienen sie dem Genesungsprozess, sind auch diese Kosten erstattungsfähig.
Erwerbsschaden als ersatzfähiger Personenschaden?
Wurde der Geschädigte bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall verletzt und kann deshalb nicht mehr arbeiten, kann er einen sog. Erwerbsschaden vom Schädiger ersetzt verlangen.
Die Höhe des Schadens richtet sich danach, ob der Geschädigte Lohnempfänger, Selbstständiger, Kind/Schüler/Auszubildender ist oder einen Haushalt führt.
Dem Lohnempfänger entsteht während der ersten sechs Wochen des Ausfalls kein Schaden, da sein Arbeitgeber 100 % der letzten Bruttobezüge bezahlt. Nach dem Ende dieser Entgeltfortzahlung erhält der Geschädigte Krankengeld von seinem Krankenversicherer. Dieses beträgt in der Regel 70 % des letzten Bruttoeinkommens. Dadurch hat der Geschädigte eine Differenz zwischen Lohn und geringerem Krankengeld, die der Schädiger erstatten muss. Der Lohnempfänger muss sich jedoch ersparte eigene Aufwendungen anrechnen lassen. Dies können beispielsweise Fahrtkosten sein, da der Geschädigte nicht zur Arbeit fahren muss und sich so Ausgaben für Auto und Benzin oder für Fahrkarten des ÖPNV erspart.
Bei Selbstständigen ist die Berechnung des Verdienstausfalles kompliziert und aufwendig. Der Verdienstausfallschaden besteht aus den Einbußen, die der Selbstständige während seines unfallbedingten Arbeitsausfalls hatte. Dazu muss er entweder konkret entgangene Geschäfte oder eine Gewinnminderung nachweisen. Dieser Nachweis gelingt häufig nur unter Mithilfe von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder entsprechenden Sachverständigen.
Bei Kindern, Schülern oder Auszubildenden ist der Schaden zu ersetzen, der durch den Ausfall in der Schule zu einem verhinderten oder verspäteten Eintritt in das Berufsleben führt. Daraus können Nachteile bei der Karriereplanung und beim Verdienst resultieren. Auch hier ist die konkrete Bezifferung des Schadens in der Regel nur mithilfe eines Gutachters möglich.
Auch dem nicht berufstätigen Geschädigten steht ein Anspruch auf Schadensersatz zu. Das ist dann der Fall, wenn er aufgrund der Verletzung seinen Haushalt nicht mehr führen kann (sog. Haushaltsführungsschaden). Auch die Haushaltsführung stellt eine Erwerbstätigkeit dar. Der Geschädigte kann eine Ersatzkraft einstellen und die Kosten hierfür konkret berechnen oder er verzichtet auf eine Hilfe und berechnet den Schaden fiktiv. Die konkrete Anrechnung wird anhand diverser Tabellen, die auf statistischen Erhebungen beruhen, abstrakt geschätzt oder mittels Fragebögen konkret errechnet. Bei einer fiktiven Abrechnung wird der Zeitaufwand für die einzelnen Tätigkeiten mit dem Grad der Behinderung und dem Nettostundenlohn einer Hilfskraft multipliziert.
Personenschaden & Haushaltsführungsschaden
Wurde der Geschädigte bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall verletzt und kann deshalb einen Haushalt nicht mehr – oder nicht mehr wie gewohnt – führen, kann er vom Schädiger den sogenannten Haushaltsführungsschaden erstattet verlangen.
Der Schaden des Verletzten ist, soweit seine ausgefallene bzw. beeinträchtigte Hausarbeit dem Familienunterhalt dient, Erwerbsschaden nach § 843 Abs. 1 Alt. 1 BGB. Soweit die Hausarbeit zur eigenen Versorgung erfolgt, kann der Verletzte wegen des Ausfalls vermehrte Bedürfnisse nach § 843 Abs. 1 Alt. 2 BGB geltend machen (vgl. BGH, Urteil v. 06.06.1989, Az. VI ZR 66/88).
Der Geschädigte hat die Wahl, ob er den Schaden konkret oder fiktiv abrechnet. Auch eine Kombination ist möglich (vgl. BGH, Urteil v. 10.10.1989, Az. VI ZR 247/88).
Stellt der Geschädigte eine Ersatzkraft ein, rechnet er konkret ab. Es ist der tatsächlich erforderliche Aufwand vom Schädiger zu ersetzen. Das ist der Bruttolohn einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (vgl. BGH, Urteil v. 08.04.1986, Az. VI ZR 59/85).
Stellt der Geschädigte keine Ersatzkraft ein und wird der Ausfall durch Mehrarbeit der Familienmitglieder, unentgeltliche Hilfe Dritter oder überobligatorische Anstrengungen des Geschädigten selbst kompensiert, rechnet er den Schaden fiktiv ab. Der zu ersetzende Mehraufwand bemisst sich nach dem Nettolohn, der für die jeweiligen Arbeiten an eine Hilfskraft hätte gezahlt werden müssen (vgl. BGH, Urteil v. 18.02.1992, Az. VI ZR 367/90). Die Höhe des ersatzfähigen Nettolohns hängt davon ab, welche Qualifikation die Ersatzkraft haben muss (z.B. einfache Putzfrau oder ausgebildete Wirtschafterin). Eine Orientierung gibt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Instanzgerichte schätzen vielfach einen pauschalen Stundensatz, der zwischen acht und vierzehn Euro liegt.
Der Geschädigte muss gegenüber der gegnerischen Versicherung seinen Schaden hinreichend darlegen und zu folgenden Punkten vortragen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 27.03.2014, Az. I-8 U 79/13):
- Der Geschädigte muss beschreiben, welche konkreten Arbeitsleistungen (Angabe der Dauer) er im Haushalt (Angabe von Zuschnitt und Größe, Anzahl der Familienangehörigen) vor dem Unfall tatsächlich erbracht hat. Zur Haushaltstätigkeit zählen dabei nicht nur die „klassische“ Tätigkeiten (Einkaufen, Kochen, Spülen, Waschen, Bügeln, Putzen, Aufräumen), sondern auch Gartenarbeit (vgl. OLG Celle, Urteil v. 16.05.2007, Az. 14 U 166/06), Wohnungsrenovierung/-reparatur, Pkw-Pflege, Schriftverkehr, Haustierhaltung und Hausaufgabenbetreuung (also Haushaltsarbeit „im weiteren Sinn“, vgl. BGH, Urteil vom 29.03.1988, Az. IV ZR 87/87).
- Dann muss der Geschädigte darlegen, in welchem tatsächlichen und zeitlichen Umfang er an diesen Tätigkeiten durch die Verletzung gehindert ist. Dies kann im Übrigen nicht anhand der MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) festgestellt werden. Diese ist nämlich abstrakt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ohne Bezug auf eine bestimmte individuelle Tätigkeit ausgerichtet. Auch wenn der Geschädigte zu 100 % arbeitsunfähig ist, kann er dennoch in der Lage sein, Tätigkeiten im Haushalt auszuführen
- Grundlage der Schadensberechnung ist dann nicht die Zeit, die der Verletzte für die ausgefallenen Arbeiten in Vergangenheit und Zukunft benötigt hätte, sondern die Zeit, die eine erforderliche (fiktive) Ersatzkraft dafür benötigen würde.
- Die Höhe des Schadensersatzes bemisst sich nach dem erforderlichen Kostenaufwand für die Beschäftigung einer „gleichwertigen“ Ersatzkraft, gleichgültig, ob sie tatsächlich eingestellt worden ist oder ob man sich anderweitig beholfen hat. Maßgebend ist der Nettolohn einer derartigen Ersatzkraft. Orientierung zur Höhe des Stundensatzes geben beispielsweise der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst oder die Tarifverträge zwischen den Landesverbänden des Deutschen Hausfrauenbunds.
UNFALL-RE
STEFANIE MOSER
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Verkehrsrecht
Fidel-Kreuzer-Str. 4
86825 Bad Wörishofen
Telefon: +49 8247 332333
E-Mail: moser@unfall-re.de
Mitgliedschaften:
Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des DAV (Deutscher Anwalt Verein), Rechtsanwaltskammer München,
Anwaltverein Memmingen, Liste „Auf Unfallschadenregulierung spezialisierte Rechtsanwälte“ der Zeitschrift IWW Unfallregulierung effektiv
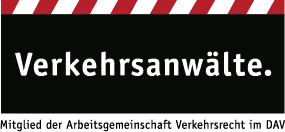

Mit dem Abschicken Ihrer Anfrage erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer angegebenen Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage einverstanden. Weitere Informationen: Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise